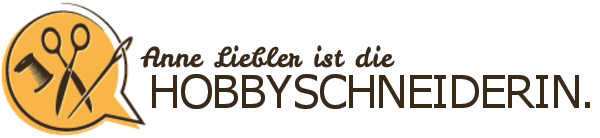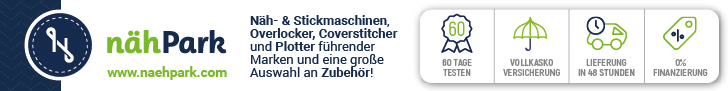Kopfkino .... ![]()
.... Stacheligel sitzt vor'm PC im Arm die Impfnadel, an der die Spritze hängt und tippt ....
sorry ... mußte sein ...;)
Kopfkino .... ![]()
.... Stacheligel sitzt vor'm PC im Arm die Impfnadel, an der die Spritze hängt und tippt ....
sorry ... mußte sein ...;)
Naja, wenn ihr hier so weiter macht, geht Sporcherin morgen los und kauft ihm eine Nähmaschine...
LG
neko
... einen Teufel werd' ich tun ... ![]() .... ich halte mich da komplett raus ...
.... ich halte mich da komplett raus ...
.... ich würde nämlich die Mama ins Auto packen und zum Nähmaschinentesttag losziehen ... ![]()
Ich sage den Nähtreff leider ab. Wünsche Euch allen viel Spaß.
Ich gehe mal davon aus, daß Du bereits alles gereinigt hast und sich im Transporteur keine Fäden und Fuselchen befinden, die das Teil an seiner Arbeit hindern.
Was spinnt denn am Transport?
Zieht die Maschine schief oder frißt sie Stoff?
Befördert sie ungleichmäßig (mal schnell, mal langsam) oder bleibt der Transporteur gefühlterweise manchmal stehen, setzt quasi aus?
Das wäre hilfreich zu wissen um ggfs. helfen zu können. Stefan weiß dann bestimmt auch Rat.
Nein, ein typisches ELNA-Problem scheint das nicht zu sein. Meine ELNA 5000 (Bj. Mitte 80er-Jahre) tut das nicht, egal welche Stoffe sie nähen soll.
In Gerolzhofen bei Schweinfurt gibt es ein Nähmaschinenmuseum.
Ich habe eine lange, eine mittlere und eine kurze Stoffschere für Baumwolle und eine mittlere Schere für Kunstfaserstoffe.
Zwei Scheren (mittel und klein) verwende ich für Papier und Karton.
Die Marke bzw. der Hersteller war mir beim Kauf nicht so wichtig, so tummeln sich Fiskar, Premax, Hetzner und No-Name
in meiner Schublade. Sehr wichtig war mir, ob sie mir gut in der Hand liegen, ob sie sich schwer anfühlen und ich sie als
angenehm empfinde.
Je eine Schere (Premax, Hetzner) hab' ich in einem kleinen Nählädchen bzw. in einer Schleiferei gekauft. In beiden Läden
wurden mir die Scheren ausgepackt, ich konnte Schneidbewegungen machen und fühlen, ob mir die Scheren angenehm
in der Hand liegen.
Die No-Name ist ein uraltes Erbstück und wurde in einer Schleiferei für Stoffschneiden aufgearbeitet. Die Fiskar (Stoff-
und Papierscheren) stammen aus dem Supermarkt.
Zwecks Kauf und evtl. Beratung wurde ich zuerst in einen Nähladen gehen. Falls sich eine Schleiferei mit Verkauf in Deiner
näheren Umgebung befindet, kann dies eine gute Alternative sein.
Gemüsemarktklasse ist sie definitiv nicht. Ich würde sagen solides Basis-Modell ihrer Zeit.
Nur wieviel Kunststoff im Inneren an der Mechanik verarbeitet ist und welche irreparablen Macken da sein könnten,
da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Die Privileg 970 Superstar Electronic wurde Maruzen/Jaguar hergestellt.
Ob sich das für Dich lohnt, mußt Du entscheiden. Ich finde den Preis für eine Wartung angemessen.
Ob es allerdings mit einer reinen Wartung getan ist, kann Stefan sicherlich besser beurteilen und
weitere Tips geben.
.... Es gibt allerdings auch Firmen, die "Aufträge" für echte Tests vergeben. Dabei bekommen die Tester Produkte, die noch nicht auf dem Markt sind. Meine Freundin hat das mal gemacht. Ich weiß nicht, ob sie dafür bezahlt wurde, aber ich denke schon. Sie musste Duschgel oder Creme testen, die neutral verpackt war und dazu ihre Meinung in einem Fragebogen wiedergeben. Und zwar bevor sie in den Regalen stand. ...
Ich denke, das fällt in den Bereich Marktforschung.
![]() gute Frage .. nur von dieser Branche hab' ich leider gar keine Ahnung.
gute Frage .. nur von dieser Branche hab' ich leider gar keine Ahnung.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß dies auf Basis anderer Verträge als Arbeits-/Beschäftigungsverträge läuft.
Wird vermutlich etwas wie Studien- oder Untersuchungsvereinbarung oder ähnliches sein. Das Risiko bei Medikamenten
ist deutlich höher als beim Nähen/Sticken.
....Also wie kann man da überhaupt noch den Weg der "Freiwilligen Ehrentester" beschreiten? Wenn das oben gesagte auf die Situation zutrifft UND es sich um eine Tätigkeit handelt, die von Freiwilligen ausgeführt wird, dann trifft das oben gesagte auf "Freiwillige Ehrentester" zu. Inclusive Vertragsdschungel, etc. etc, der ja bestehen müsste, auch wenn er nicht besteht, weil aus den Bedingungen ein Beschäftigungsverhältnis abgeleitet werden kann, wie du schreibst. Warum soll dann der Weg der "Freiwilligen Ehrentester" einfacher sein? Bzw. worin besteht der Unterschied? Das verstehe ich gerade nicht.
Mein Beispiel enthält alle eventuell möglichen Vertragsverhältnisse, die je nach Auslegung aus so einer Aktion herausgelesen werden könnten. Ich wollte damit nur aufzeigen, was es für verschiedene Varianten gibt. Würde der Tester dafür bezahlt werden, dann kämen all diese Punkte für die Beurteilung des Vertragsverhältnisses in Betracht.
Jede Firma, die Tester benötigt, verschickt kostenfreie Warenmuster, niemals Aufträge. Dazu kommt noch ein weiterer, wesentlicher Punkt, ob der Tester dies wegen des überwiegenden Bestreitens seines Lebensunterhalts tut (bezahlte Tätigkeit) oder ob er dies sporadisch und gelegentlich (unentgeltlich) ausführt. Also ob eine dauernde Erwerbsabsicht (Haupteinkommen) dahinter steht oder ein Hobby.
Das Themengebiet kann von einem Arbeitsrechtler noch in kleinere Details zerlegt werden. Ich habe versucht es von der Personalseite her zu erklären, da eine Firma verschiedene Möglichkeit hat, Verträge für solche Tätigkeiten zu gestalten.
Dazu mal ein kurzer Ausflug ins Arbeits- und Sozialrecht:
Zum einen gibt es den sozialrechtlichen Begriff "Beschäftigungsverhältnis", vereinfacht dargestellt eine abhängige Beschäftigung nach Weisung. Das ist grundsätzlich gesehen versicherungspflichtig. (Den öffentlichen Dienst lasse ich absichtlich außen vor.)
Zum zweiten gibt es den Begriff des Arbeitsverhältnisses, der vereinfacht ausgedrückt eine unselbständige Tätigkeit in Sinne des Rechts ist. (Den öffentlichen Dienst lasse ich absichtlich außen vor.)
Dann gibt es Selbstständige, die entweder in Bereich des Handwerks (in der Handswerkkammer gelistete Berufe) oder in Industrie- und Handel (gelistete Berufe der IHK) oder in sog. freien Berufen (Freiberufler nach gelisteten Berufen) tätig sind. (Die anderen Sonderfälle lasse ich bewußt weg.)
So weit - so gut. Doch nun wird's kompliziert.
Eine selbstständige Handwerkerin, z.B. Schneiderin, erstellt nach Auftrag ein Gewerke (z.B. Kleid) mit dafür eingekauften Material in ihren eigenen Räumlichkeiten mit Nutzung ihrer eigenen Werkzeuge und Maschinen. Hierfür wird ein Werksvertrag (umgangssprachlich Fertigungsvertrag) geschlossen. Ein Anspruch auf Vergütung des Gewerkes besteht nur, wenn der Gewerkeempfänger dieses als mangelfrei abnimmt. Die Haftung (allgemein) liegt beim Gewerkeersteller. (Stellt die Kundin Material und Schnittbogen, könnte man schon wieder darüber nachdenken, ob sie sich im Bereich der Lohnfertigung bewegt - berücksichtigen wir hier nicht.)
Es entsteht kein Arbeitsverhältnis, u.U. allerdings ein Beschäftigungsverhältnis, nämlich dann, wenn die Handwerkerin ausschließlich für einen Kunden über einen längeren Zeitraum arbeitet. Findet oft in der IT-Branche oder in Beratungsberufen im Rahmen von Projekt- bzw. sog. Dienstleistungs- oder Rahmenverträgen Anwendung, in dem, neben anderen Vereinbarungen, die Sozialversicherungspflicht des Auftraggebers (die er ganz grundsätzlich mal hätte) ausgeschlossen wird, da der Vertrag mit einem Selbstständigen Gewerbetreibenden oder Freiberufler geschlossen wird.
Eine Mitarbeiterin in einem Betrieb, die normal (Teil- oder Vollzeit) arbeitet hat sowohl ein Beschäftigungs- als auch ein Arbeitsverhältnis, denn sie unterliegt der Sozialversicherungspflicht und dem Arbeitsrecht. Sie führt alle Tätigkeiten nach dem Direktionsrecht ihres Arbeitgebers, der Firma bzw. nach der Weisungsbefugnis der Vorgesetzten aus.
Sie arbeitet in dessen Räumlichkeiten mit dessen Maschinen und Material. Das ist jedem aus eigener Praxis bekannt. (Es ist ein Irrglaube, daß ein Mini-Job nicht nicht versicherungspflichtig ist. Der Arbeitgeber hat für den gewerblichen Mini-Jobber immer Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Es besteht lediglich die Wahlmöglichkeit für den Beschäftigten bei Mini-Job-Zentrale (Knappschaft-Bahn-See) einen Betrag von erzielten Entgelt in die Rentenversicherung einzuzahlen. - Das nur am Rande.)
So und nun zum konstruhierten Fall:
Eine ausgebildete Ärztin (Freiberufler), die derzeit nicht tätig ist (Hausfrau), kein Gewerbe angemeldet hat und keinerlei Bezüge aus den Staatskassen bezieht, näht als versierte Hobbynäherin (Privatperson, Herstellung) für eine Firma (Auftraggeber) binnen einen festgesetzten Zeitraums (Direktionsrecht) nach einem gestellten Schnitt (zur Verfügung gestelltes Material, Arbeitsanweisung) drei Modelle (Gewerke, Auftragsarbeit) mit eigenem Material (Einkauf) ohne jegliche Vergütung daheim (Heimarbeit) zur Probe. Danach gibt sie ihre "Bewertung" (Beratung) über Schnitt und Beschreibung ab.
... und schwups befindet sich die Probnäherin in einem diffusen Vertragsdschungel, zwischen angeordneter Arbeit, Beschäftigungsverhältnis und selbstständigem Gewerke, sowie ggfs. in der Sozialversicherungspflicht. (Auch Übungsleiter im Sportverein ohne Aufwandsentschädigung sind über den jeweiligen Landessportverband versichert.)
Bekommt sie nun das Schnittmuster geschenkt, könnte dies als freiwillig soziale Leistung des Arbeitgebers verbucht werden, wenn sie denn ein Arbeitsverhältnis hätte oder als geldwerter Vorteil, wenn da ein Beschäftigungsverhältnis bestünde, was sie eigentlich nicht hat, das aus den Bedingungen allerdings abzuleiten wäre.
Auch Heimarbeit unter besonderen Bedingungen könnte in Betracht gezogen werden. (weit hergeholt, ich weiß). Um nun die vollendete Verwirrung zu erwirken, könnte überlegt werden, inwieweit diese Probenähtätigkeit unter "freie Mitarbeiterin" (Freelancer) einzuordnen sein könnte.
Dies ist alles absichtlich sehr vereinfacht und sehr plakativ ausgedrückt, weil ich aufzeigen wollte, welche Hürden für die Firmen hinter solchen "Probetätigkeiten" stecken. (Seit ca. 20 Jahren bin ich "Personalfuzzy" und hab' täglich mit solchen Dingen zu tun.)
Viel komplizierter wird's noch, wenn Bezüge aus der Staatskasse, eine Hauptbeschäftigung und/oder Nebenbeschäftiung oder kurzfristige Beschäftigung, sowie Arbeitsunfähigkeit (Krankheit) oder besondere Rentenformen (Teilerwerbsrente etc.) vorliegen, von den ordnungsgemäßen Meldungen bei den diveren Stellen und dem Schriftkram mal ganz abgesehen.
Da ist es schon nachvollziehbar, daß sowohl kleine Start-Up-Unternehmen als auch etablierte Firmen, den einfacheren Weg der "Freiwilligen Ehrentester" wählen.
Ob und wie weit, daß jemand tun möchte, für sich selbst als gut oder schlecht bewertet, liegt in der Entscheidung eines jeden selbst. Wichtig finde ich dabei nur, daß man für sich selbst etwas positives daraus mitnehmen kann, in Form von Freude, neuen Erkenntnissen, Wissen oder einfach nur Erfahrungen.
Wachstuch läßt sich gut vernähen.
Empfehlenswert ist, auf einem kleinen Stückchen des Wachstuches auszuprobieren mit welcher Nadel (Stärke und Art) die Naht am besten aussieht und die Einstichlöcher am kleinsten sind. Meiner Erfahrung nach ist die Nähnadel nach vielen Metern in Wachstuch am Ende der Näharbeit nicht mehr für normalen Stoff zu gebrauchen und muß entsorgt werden.
Zur Größe der Tischdecke schließe ich mich der Meinung von Benzinchen an. Es ist Geschmackssache, wie weit eine Tischdecke vom Tisch herunter hängen soll und vielleicht davon abhängig ob Du Beschwerungsteilchen (diese Teile, die mit Clip angebracht werden, damit die Tischdecke bei Wind nicht hochfliegt) verwendest, sowie ob Du noch kleine Kinder daheim hast, die ggfs mit ihren Füßen die Tischdecke ungewollt beim Aufstehen vom Tisch ziehen.
Viel Erfolg beim Nähen. ![]()
Ist nur die Frage, ob man/frau noch im trend liegt, wenn dasT-Shirt selbst genäht ist und nicht von einer angesagten marke stammt
selbst genäht ist die beste "Marke", die frau haben kann ![]()
![]() ... grumpfl ... der Termin des Nähtreffens fällt genau mit dem Termin der Saisoneröffnungstour zusammen. Wenn sieben Sonnen am Himmel stehen, die Temperaturen um die 8 Grad C im Plus sind und es am Freitag nicht geregnet hat, dann werde ich leider nicht dabei sein.
... grumpfl ... der Termin des Nähtreffens fällt genau mit dem Termin der Saisoneröffnungstour zusammen. Wenn sieben Sonnen am Himmel stehen, die Temperaturen um die 8 Grad C im Plus sind und es am Freitag nicht geregnet hat, dann werde ich leider nicht dabei sein.
![]() ... ist man mal nicht dabei, wird da verführerische Wäsche produziert ...
... ist man mal nicht dabei, wird da verführerische Wäsche produziert ... ![]()
@ Uli - gute Besserung, das wird schon wieder.
Moin-Moin,
lieben Dank.
Taille 90 - bzw. 45 +2 = 47
Hüfte 129 - bzw. 65 +2 = 67 ( 25 cm Abstand Taillenlinie zur Hüftlinie)
Ausfall = 20 cm
Hüftbogen = 10 cm für links und rechts, die auf 25 cm Höhenunterschied aufgeteilt werden
Hab' ich das jetzt richtig wiedergegeben?
Und wie male ich jetzt den Hüftschwung? Gleichmäßig oder als abgeflachte Kugelrundung?
![]() Kann mir bitte jemand in einfachen Worten erklären, was der Ausfall ist und wozu dieser Wert gut ist?
Kann mir bitte jemand in einfachen Worten erklären, was der Ausfall ist und wozu dieser Wert gut ist?
So wie ich das in meinem schlauem Buch gelesen habe, ist das der Umfangsunterschied zwischen Hüfte und Taille bei Röcken und Kleidern. Wieviel Abstand muß denn zwischen der Taillen- und der Hüftmessung sein? Frei der Nase nach oder gibt's da je nach Kleidergröße einen Richtwert? Und was hilft es mir, wenn ich den Wert weiß?
Wie berechne ich die Biegung/Rundung meiner Hüfte? Macht es Sinn mich gegen die Wand zu stellen und den Bogen, den die Hüfte macht nachzuzeichnen oder ist das eine völlig falsche Heransgehensweise?
Nach den Maßen der Konfektionsgrößen in meinem Buch sind da 22 cm bzw. 21 cm bzw. 20 Unterschied zwischen Hüfte und Taille - je größer die Größe, desto weniger Unterschied. Leider finde ich mich da gar nicht wieder, denn ich habe 37 cm Differenz zwischen Taille und Popöchen ....
Ich versuche gerade mich in die Schnittkonstruktion einzulesen, was mir wegen fehlenden Nähkenntnissen und den verwendeten Fachwörtern etwas schwer fällt. Wäre nett, wenn Ihr etwas Licht in die dunkle Nähstube bringen könnten. Vielen Dank.
Von mir ein klares nein.
Ich nähe bzw. häkele teilweise Strick- oder Häkelteile reihengenau an der jeweiligen Randmasche zusammen, nutze dazu auch die Fadenenden des Strickwerks und das ist mir mit der Nähmaschine nicht möglich.
![]() Kurzfristig mußte ich meinen Plan für's Wochenende ändern, deshalb sage ich für's Treffen ab.
Kurzfristig mußte ich meinen Plan für's Wochenende ändern, deshalb sage ich für's Treffen ab.
Ich wünsch' Euch ganz viel Spaß beim Nähen, Plaudern und Futtern. ![]()