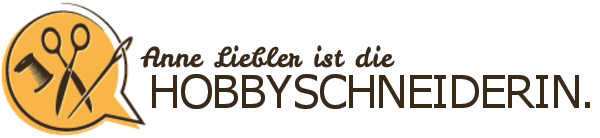Um ein wenig Licht ins Nadelöhr zu bringen,
hier einmal ein paar Basics zum Thema Nadeln:
Wie den meisten schon aufgefallen ist, gibt es tatsächlich, nicht nur verschiedene Größen von Nadeln, sondern auch unterschiedliche Spitzen und Nadelöhre etc.
Maschinenbedingt macht es auch Sinn noch verschiedene Nadeln für verschiedene Nähmaschinenarten zu produzieren.
So haben Stickmaschinen andere Nadeln als Schusternähmaschinen, Schnellnäher andere Systeme als Haushaltsmaschinen,
Overlocks andere Nadeln als Haushaltsmaschinen.
Damit denn wenigstens die Profis wissen wie die Einzelteile einer Nadel heißen, wenn der eine vom anderen etwas braucht
und dies zu beschreiben versucht, hat man sich auf eine Norm geeinigt: DIN 5330-1
Nadel-DIN.jpg
In dieser DIN sind jetzt schon einmal alle Nadelteile benannt und somit kann man sich unter einander auch besprechen
ohne das Mißverständnisse auftreten. Ganz wichtig für uns ist die Kolbenform, es gibt Rundkolben und Flachkolben
(die Sonderformen im Bild ignorieren wir jetzt einfach). In den meisten neueren Nähmaschinen werden Flachkolben verwand,
das hat den Vorteil, das (bis auf einige wenige "Künstlerinnen") die Nadel nicht mehr falsch eingesetzt werden kann.
Der Nachteil zum Rundkolben ist, das die Nadel dem Material nicht mehr angepasst werden kann
(sprich, durch leichtes Verdrehen der Nadel kann man bei schwierigen Materialien die Fehlstiche vermindern/vermeiden).
Der Nadelkolben hat entsprechend seiner Systemzugehörigkeit einen bestimmten Durchmesser,
auch dieser Durchmesser muß passen, sonst lässt sich die Nadel nicht richtig befestigen.
Kolbenformen.jpg
An den Kolben schließt sich der Schaft an. Im Schaft befinden sich sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Nutseite(Rückseite) Rinnen.
In diesen Rinnen wird der Faden geführt. Auf der Vorderseite zum Öhr hin, auf der Nutseite vom Öhr weg. Der spannende Teil ist eigentlich der rückwärtige Nutbereich.
Beim Einstechen der Nadel wird der Faden durchs Material auf die Unterseite gezogen, beim Hochheben der Nadel muß der Faden auf der Vorderseite
wieder mit nach oben gezogen werden, der Faden auf der Nutseite soll aber auf der Stoffunterseite bleiben und beim Anheben der Nadel eine Fadenschlinge bilden.
Diese Fadenschlinge fängt der Greifer (Hook) ein und verschlingt sie mit dem Unterfaden. Dieser ganze Vorgang ist auf Bruchteile von Millimetern ausgelegt.
Je nach Material werden nun diese Nutseiten mit anderen Rillenformen ausgestattet. (Gar nicht so einfach, so eine Nadel zu bauen)
Rinnenform.jpg
Und um das Ganze richtig kompliziert zu machen, braucht auch jedes Material seine eigene Spitze und ein spezielles Öhr.
Im letzten Bild sind ein paar Spitzenformen gezeigt, die den Unterschiede zwischen spitz, rund, halbrund, schneidend etc. verdeutlichen (zur Beruhigung, es gibt noch viel mehr Varianten :D).
Spitzenform.jpg
Ich denke, damit sind erstmal alle Klarheiten beseitigt und sämtlichen Spekulationen Tür und Tor geöffnet.
Die diversen Sonderformen von Nadeln habe ich bewußt nicht erwähnt, es sei aber gesagt, es gibt gebogene Nadeln, Nadeln mit Öhr in der Mitte, Nadeln mit zwei Öhren und vieles mehr.
Besonders bedanken möchte ich mich hiermit bei der Firma Schmetz, die mir die Zeichnungen und Informationen hat zukommen lassen,
so daß ich hier im Forum das Wissen um die Nadel und Nadelsysteme besser darstellen konnte.
) und warum sie für die genannten Tätigkeiten besonders zu empfehlen ist?